Genau wie Dörfer und Städte können Firmenzentralen nicht nur Infrastruktur und Schutz, sondern auch Identität und Wurzeln bieten. Der renommierte Architekt Sir David Chipperfield und Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, trafen sich in dem von Chipperfield entworfenen Galeriehaus am Kupfergraben in Berlin. In den Räumen der Contemporary Fine Arts Galerie – gegenüber dem von Chipperfield meisterhaft rekonstruierten Neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel – sprachen sie darüber, wie Architektur zur Förderung unternehmerischer Ziele beitragen kann; und das in einer Zeit, in der sich Wertvorstellungen und Bedürfnisse ändern und Identitäten unbeständig sind. Zusätzlich an Spannung und Relevanz gewann das Gespräch durch den Umstand, dass das Verlagshaus Springer sich mitten in einem Designwettbewerb für einen ambitionierten „New Media Campus“ in Berlin befindet – mit der Zielsetzung, seine unterschiedlichen journalistischen Bereiche aus traditionellen und neuen Medien zusammenzuführen.
Mathias Döpfner: Schon immer haben Unternehmen mit ihren Gebäuden auch den Geist zum Ausdruck bringen wollen, der innen herrscht – von betont schlichter Bescheidenheit über schnörkellose Modernität mit klaren Linien und glatten Fronten bis zu aufwendigen Prunkbauten. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass umgekehrt Ästhetik und Design auch einen starken Einfluss auf den Umgang miteinander und auf die Kultur in einem Unternehmen haben können.
Sir David Chipperfield: Ich beobachte, dass wir in Zeiten leben, in denen Führung vor allem die Aufgabe hat, Risiken zu minimieren, indem sie sich an Zahlen hält. Das macht es schwieriger, den weniger messbaren Faktoren des Lebens eine Stimme zu verschaffen. Das ist eine der Herausforderungen, denen sich die Architektur – wie übrigens der gesamte Kulturbereich – stellen muss. Heutzutage bewertet man ja sogar Museen anhand ihrer Besucherzahlen; im Grunde wird alles in Zeit und Geld gemessen. Doch für das Abstrakte haben wir keine Maßeinheit. Es gibt keine Methode, mit der wir ausdrücken könnten: „Zahlenmäßig waren es zwar nicht so viele Besucher, doch die, die kamen, waren tief beeindruckt!“ Es lässt sich einfach nicht messen, welche Eindrücke man in jemandes Gehirn hinterlassen hat. Möglicherweise hat man das Leben von zehn Museumsbesuchern verändert, und vermutlich ist das sogar das Wesentliche – doch wann ist davon je die Rede? In der Architektur sollten wir uns eigentlich immer an den drei Dimensionen Zeit, Geld und Qualität orientieren, und jedes Projekt sollte jeder dieser Dimensionen gleichermaßen gerecht werden. Doch allzu oft werden zunächst ehrgeizige Vorhaben auf die Faktoren Zeit und Geld reduziert und verflachen damit. Qualität hingegen ist nicht absolut, und es ist sehr schwierig, den weniger leicht quantifizierbaren Aspekten ausreichend Beachtung zu verschaffen.
Döpfner: Da stimme ich Ihnen zu. Ich glaube, gerade heute, im Zeitalter der Digitalisierung und angesichts riesiger Datenmengen, erliegen wir zunehmend dem Trugschluss, alles sei komplett quantifizierbar – und jede Entscheidung könne anhand messbarer Kriterien getroffen werden. Doch wenn Zahlen und Messbarkeit die einzigen Grundlagen für eine Entscheidung darstellen, ist die Wahrscheinlichkeit einer Fehlentscheidung ziemlich hoch. Ich habe das in meiner beruflichen Laufbahn mehrmals festgestellt. Eigentlich bräuchten wir Fürsprecher für qualitative Faktoren, wie etwa die Architektur. Wir spüren, dass es dringend notwendig ist, eine neue Unternehmenskultur zu entwickeln, die die Mitarbeiter der alten und der neuen Medien zusammenbringt – Menschen mit sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, Lebensstilen und Arbeitsweisen. Deshalb planen wir ein neues Gebäude. Natürlich könnte man die Frage stellen, wozu wir in der Zeit der digitalen Ökonomie überhaupt ein neues Gebäude brauchen. Heute lässt sich im Prinzip alles von zu Hause aus erledigen, und niemand benötigt einen Arbeitsplatz im herkömmlichen Sinne. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass eine Neudefinition von Arbeit und Arbeitsraum, ein attraktives, neu gestaltetes Arbeitsumfeld die Menschen zusammenbringen kann. Wir sehen das neue Haus auch als ein konkretes Beispiel für den Ansatz, Unternehmenskultur mithilfe eines ästhetischen Projekts zu verändern.
Chipperfield: Unsere Generation ist mit der Annahme aufgewachsen, Architektur sei ein „Change Agent“, ein Katalysator. Sie ist es aber nicht per se. Wer nur das Fassadenmaterial auswechselt und vielleicht ein paar Fenster neu platziert, bewirkt damit gar nichts. Wirklich etwas verändern kann man nur, wenn man an die Substanz eines Gebäudes geht – und dazu braucht es, genau wie Sie sagen, den bewussten Wunsch nach Veränderung. Mir ist aufgefallen, dass sich in Deutschland hauptsächlich mittelständische Unternehmen intensiv mit ihrer Unternehmenskultur auseinandersetzen. Es beeindruckt mich sehr, wie viel Geld und intensive Überlegungen sie in langfristige Vorhaben, wie zum Beispiel klug konzipierte Firmengebäude, investieren. Das ist in anderen Ländern in dieser Ausprägung nicht zu finden.

Döpfner: Vielleicht liegt es daran, dass mittelständische Unternehmer Eigentümer sind. Sie fühlen sich ihrem Unternehmen und ihren Mitarbeitern gegenüber persönlich verpflichtet und sind mit beiden auch emotional stark verbunden.
Chipperfield: Und sie denken langfristig. Gerade in der angelsächsischen Welt lässt sich hingegen beobachten, dass Kurzfristigkeit zum Hauptanliegen wird – und Kurzfristigkeit führt nicht zu Investitionen in Architektur. Ich habe vor einiger Zeit die Unternehmenszentrale des Traktorenherstellers John Deere in Illinois besucht. Es ist eines der großartigsten Firmengebäude der Welt, mitten im ländlichen Mittleren Westen. Gebaut wurde es in den sechziger Jahren von Eero Saarinen. Das Unternehmen hat damals richtig viel in diesen beeindruckenden Bau investiert, ebenso wie in den umgebenden Park, entworfen vom besten amerikanischen Landschaftsarchitekten der damaligen Zeit. Leute reisen nur wegen dieses Gebäudes dorthin – ein Bauwerk, das zu einer Zeit entstand, als John Deere noch von der Eigentümerfamilie geführt wurde. Man ist sich dort bis heute bewusst, dass die Entscheidung für diesen Bau eine der besten war, die die Firma jemals getroffen hat. Die Mitarbeiter sind immer noch unglaublich stolz, dort zu arbeiten. Würde man allerdings allein nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten darüber entscheiden, dann käme ein solches Gebäude heute nicht mehr zustande.
Döpfner: Manchmal erweisen sich Entscheidungen, die einem unvernünftig, subjektiv oder emotional erscheinen, letztlich als die weisesten und besten – während Entscheidungen, die stark auf Fakten und Zahlen basieren, die schlechtesten sein können. Deshalb ist es nur logisch, dass eigentümergeführte – und damit meist mittelständische – Unternehmen sich mehr Gedanken um diese Dinge machen als Manager, die große Unternehmen leiten. Sie sind bürokratischer orientiert, müssen es meist auch sein, denn ihr Erfolgskriterium sind vor allem ihre Quartalsergebnisse. Mich würde interessieren, wie Sie den Faktor Schönheit und dessen Rolle einschätzen. Ich bin nämlich vielen Architekten begegnet, die da abwinken: „Ach wissen Sie, Schönheit …“
„Manchmal erweisen sich Entscheidungen, die unvernünftig oder emotional erscheinen, letztlich als die weisesten und besten.“ - Mathias Döpfner
Chipperfield: Darüber sprechen wir tatsächlich nie gerne.
Döpfner: Aber geht es am Ende nicht auch um Schönheit? Natürlich gilt seit Bauhaus-Zeiten der Satz „Form follows function“, doch es geht ja auch um Ästhetik im eigentlichen Sinn.
Chipperfield: Normalerweise rutschen wir bei dieser Frage nervös auf unseren Stühlen hin und her, weil wir unsere Arbeit nicht basierend auf wolkigen Versprechungen verkaufen können. Eines der Probleme von Architekten besteht doch darin, dass wir zunächst nur die Idee eines Bauwerks anbieten. Natürlich gibt es Modelle, und moderne, dreidimensionale Computersimulationen erlauben es heute, schon lange vor der Fertigstellung eines Gebäudes virtuell durch die Räume zu spazieren. Aber es braucht noch immer sehr viel Vorstellungskraft dafür, wie das fertige Gebäude in seinem Umfeld wirkt, welche Atmosphäre es ausstrahlen wird; großartig, erhaben, einladend, kühl oder abweisend, erdrückend – und ja, auch schön oder hässlich, wobei das dann ja noch einmal eine sehr subjektive Rezeption ist. Wenn ein Künstler ein Bild gemalt hat, kann er es Ihnen in seinem Atelier vorführen, und Sie können ihm sagen, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Sie beurteilen das Ergebnis. In der Architektur verwenden wir jedoch, um einen Auftrag zu bekommen, 95 Prozent unserer Zeit vor der Fertigstellung dafür, zu erklären, wie das Objekt nach der Fertigstellung sein wird. Im Grunde frage ich mit meinem Designstudio also: „Darf ich jetzt anfangen? Geben Sie mir das Geld dafür?“ Wir wollen einen Auftrag erhalten und müssen dafür eine Sprache finden, die Vertrauen schafft – und das Versprechen von Schönheit passt da nicht so gut hinein.
Döpfner: Also sprechen Sie auch lieber über das, was nachvollziehbar und messbar ist.
Chipperfield: James Sterling und Ludwig Mies van der Rohe haben immer gesagt: „Erkläre dem Klienten niemals das Projekt. Erkläre niemals die schwierigen Dinge. Erkläre die vernünftigen Dinge.“
Döpfner: Mein Vater war Architekt und hat mir davon abgeraten, die gleiche Laufbahn einzuschlagen. Er fand, die Zeit der anspruchsvollen Architektur sei vorbei, da es keine echten Bauherren mehr gäbe – jeder Laie sei davon überzeugt, sich mit den Details besser auszukennen als der Architekt. Der Bauherr hat seinen eigenen Geschmack, seine eigenen subjektiven Vorlieben, mischt sich ein. Das ruiniert jedes architektonische Meisterwerk. Ein guter Auftraggeber muss voll darauf vertrauen, dass sein Architekt eine hervorragende Lösung finden wird.
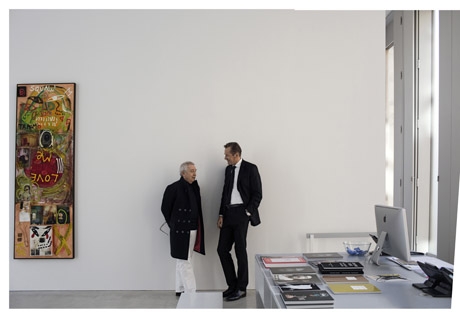
Chipperfield: Wichtig ist auch das Vertrauen in den Dialog, denn der Architekt selbst ist beim jeweiligen Projekt immer nur so gut wie der Bauherr. Es ist wie beim Tennis: Ein zu guter Gegner demoralisiert einen, doch auch ein schlechter Gegner ist problematisch, denn dann fängt man selbst an, den Ball ins Netz zu schlagen. Also braucht man einen guten Partner. Ich weiß, dass wir bei guten Beziehungen zu unseren Klienten mehr leisten. Und ich finde nicht, dass Auftraggeber nur sagen sollten: „Okay, hier ist der Bauplatz. Machen Sie damit, was Sie wollen.“
Döpfner: Eine solche Aussage könnte ja auch mangelndes Interesse signalisieren. Auf eine Unternehmenskultur etwa kann Architektur nur reagieren und diese beeinflussen, wenn das Architekturbüro sich intensiv mit dieser Kultur auseinandersetzt, sie versteht und eine Verbindung zum Bauwerk hergestellt werden kann. Ich denke, dann beeinflussen Architektur und Kultur einander gegenseitig.
Chipperfield: Ja, ein Architekt ohne einen mitdenkenden und fühlenden Bauherrn hat wenig Spielraum. Der Architekt kann Möglichkeiten und Ideen anregen, doch dafür braucht er einen Adressaten. Ich denke, wir brauchen immer eine Art von Dialog, denn Architektur ist für den Menschen da. Sie bildet die Kulisse. In gewisser Hinsicht geht es um Bühne und Schauspieler. Wir sollten also den Großteil der Zeit auf die Erschaffung der Bühne verwenden – und dann andere Leute darauf spielen lassen.
Döpfner: Genau das erhoffe ich mir von der neuen Unternehmenszentrale für Springer. Es geht darum, die richtige Bühne zu schaffen, damit die kreative DNA des Unternehmens erhalten bleibt. Wir sind traditionell ein Inhalte- und Kreativ-Unternehmen. Die große strategischen Frage für uns lautet: Werden die Technologieunternehmen den genetischen Code der Kreativ-Unternehmen übernehmen und Inhalte produzieren? Oder sind die Inhalte-Unternehmen in der Lage, sich auf die Plattformen der neuen Technologien zu begeben und die Sprache der Technologie verstehen zu lernen, um damit erfolgreiche Produkte für die digitale Zukunft zu erschaffen?
Chipperfield: Das ist eine große und offene Frage.
Döpfner: Ja, noch ist nichts entschieden. Zurzeit spricht zwar mehr für den Erfolg der Technologieunternehmen. Langfristig erscheint es wiederum wahrscheinlicher, dass sich die Content-Unternehmen durchsetzen werden, da sich deren kreative DNA nur schwer kopieren lässt. In unserem Unternehmen gibt es derzeit zwei Welten: Technologieanhänger, die finden, Inhalte würden überbewertet und es sei unnötig, viel Geld dafür auszugeben. Und dann gibt es die Verlagsvertreter alter Schule, nach deren Meinung die Technologie den Journalismus kaputt macht. Sie sehen es als das Ende einer Kultur und tun sich sehr schwer damit, überhaupt zu verstehen, worüber die Technologievertreter sprechen. Ich denke, wir müssen das Beste aus beiden Welten vereinen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere besten IT-Entwickler unmittelbar mit den besten Journalisten, Autoren und Reportern zusammenarbeiten. Denn nur wenn beide Seiten wissen, was technologisch möglich ist, sind beide Seiten auch in der Lage, gemeinsam das beste kreative Produkt herzustellen. Deshalb muss unser neues Gebäude extrem kommunikationsfördernd sein. Es soll so gestaltet werden, dass beide Seiten nicht nur miteinander reden können oder es müssen, sondern dass sie miteinander reden wollen.
Chipperfield: Architektur ist ja im besten Fall die Antwort auf zwei menschliche Grundbedürfnisse: Einerseits bietet sie Obdach und Schutz, andererseits ermöglicht sie, dass Menschen zusammentreffen und sich austauschen. Gebäude sind die physische Verkörperung von Gesellschaft, und wir als Architekten versuchen, Formen zu erschaffen, die diese sozialen Bestrebungen widerspiegeln und unterstützen. Mit Ihrem Gebäude erschaffen Sie eine Art internen Dorfplatz. Sie signalisieren: Jeder, der für uns arbeitet, gehört zu unserer Gemeinde und kann sich im gemeinschaftlichen, offenen Raum entfalten. Es muss Platz geben für spontane Begegnungen und regelmäßigen Austausch. Zwischen Menschen, die hinter Wänden in Einzelbüros sitzen, gibt es wenige Berührungsflächen – im positiven wie im negativen Sinn.
Döpfner: Unser Kulturwandel-Projekt soll das Alte und Neue zusammenbringen, ohne eine Harmonie vorzutäuschen, die nicht existiert. Ein gewisser Kontrast und Differenzen müssen bleiben, denn gerade durch die Kombination von Alt und Neu, Tradition und Avantgarde sollen neue Ideen entstehen. Nach der NSA-Affäre gehe ich allerdings davon aus, dass wir davon abkommen werden, alles mit jedem zu teilen, und die Menschen wieder verstärkt auf ihre Privatsphäre, auf Sicherheit und Datenschutz achten werden. Viele werden nicht länger tolerieren, dass jemand all ihre Daten sammelt, verwendet oder gar missbraucht. Was denken Sie: Was bedeutet das für die Architektur? Ich glaube nämlich, dass auch der Trend zum Gemeinschaftsbüro vorbei ist. Vielmehr geht es jetzt um gemischte Modelle, die sowohl individuelles als auch gemeinsames Arbeiten ermöglichen.
Chipperfield: Ich denke, dass wir es mit verschiedenen, zum Teil widersprüchlichen Trends zu tun haben. Wir glauben immer, dass sich alles ändert – und dabei ändert sich in Wahrheit nichts. Diese Widersprüchlichkeit finde ich auch in mir selbst als Architekt: Da ist der Pessimist in mir, der mir ständig sagt, dass Qualität nicht länger gefragt ist, dass der einzige Inhalt der Architektur darin besteht, schnell und billig zu bauen, dass niemand mehr Werte schätzt und wir tatsächlich auf eine Art synthetische Normalität zusteuern, die weder gut noch schlecht, sondern einfach nur okay ist. Doch dann gibt es immer wieder Momente voller Optimismus, in denen mir klar wird, dass diese Werte nicht verloren sind und die Menschen nicht alles ästhetische Verständnis aufgegeben haben. Wir beschäftigen uns mit Gegenständen, die nicht sprechen und sich nicht selbst erklären können. Gebäude sind nicht beschriftet; sie können keine Kritik oder Rechtfertigung abgeben. Immer, wenn es im Studio ein Problem gibt und meine Mitarbeiter deswegen in Konflikt mit dem Bauherrn geraten, sage ich ihnen: „Letztlich kann man ja nicht an die Fassade des Hauses schreiben: ‚Dieses Gebäude wäre besser geworden, wenn der Auftraggeber verständnisvoller gewesen wäre, der Bauunternehmer mehr Geduld gehabt hätte und, und, und …‘ “ Architektur äußert sich nicht und kann sich nicht verteidigen – sie ist stumm. Sie kann nur durch ihre physische Präsenz etwas mitteilen, durch Material, Raum, Licht. Das ist die einzige Sprache, die die Architektur besitzt, und dieser Sprache müssen wir uns bedienen. Ich glaube wirklich, dass solche Momente in einer stetig synthetischeren Welt immer seltener werden – was sie umso wertvoller macht.
Döpfner: Momente von Authentizität.
Chipperfield: Ja, aber es gibt sie. Es ist interessant zu sehen, wie sehr sogar dieses Gebäude, in dem wir jetzt sitzen, Menschen anspricht und berührt. Es ist ja eigentlich gar nichts Besonderes: Die Räume sind groß, es ist wunderbar ausgeführt, das Licht ist fantastisch, aber das ist auch alles. Ich fand es deshalb umso bemerkenswerter, als der Eigentümer mir erzählte, dass viele Leute einfach an das Gebäude herantreten, nur um die Außenwand anzufassen. Zunächst forderte er sie auf, das zu unterlassen, bis er erkannte, dass es sich bei dieser Geste um eine Art Kompliment handelte. Und als wir das Neue Museum eröffneten, musste ich an diese Menschen denken – Menschen, die sich hinknieten, nur um zu sehen und zu fühlen, wie und woraus bestimmte Dinge gefertigt waren. Das gab mir ein enormes Gefühl der Zuversicht und Hoffnung darauf, dass nicht alles verloren ist. Allerdings sind diese zwei Positionen schwer zu vereinen. Ich nehme an, es ist ein bisschen wie mit dem Essen: Einerseits wollen wir unsere Mahlzeiten so schnell und billig wie möglich, andererseits sind wir bereit, sehr viel Geld für ein einziges Abendessen zu zahlen. Es sind Parallelwelten: Man kann für 58 Pence bei McDonald’s essen gehen oder im Restaurant zwei Türen weiter 150 Pfund ausgeben.
„Im Zeitalter der Digitalisierung und angesichts riesiger Datenmengen erliegen wir zunehmend dem Trugschluss, alles sei komplett quantifizierbar.“ - Mathias Döpfner
Döpfner: Was für Architektur und Essen gilt, trifft auch auf den Journalismus zu. Und was Sie gerade über das Hin-und-her-gerissen-Sein zwischen Kulturpessimismus und -optimismus gesagt haben, das beschreibt genau meinen eigenen etwas schizophrenen Gemütszustand. Manchmal denke ich: Es geht auch in unserem Metier nur noch darum, dass alles schnell geht und kurz ist – Info-Fastfood eben. Man braucht kein Gedächtnis mehr, und auch die Sprache, das Geschichtenerzählen spielen keine Rolle mehr. Layout? Interessiert niemanden. Es geht nur noch um die Produktion von News, wie in einer Werkshalle. Doch dann mache ich auch wieder völlig gegensätzliche, sehr positive Erfahrungen – wenn zum Beispiel ein Text, an dem ein talentierter Autor zwei Monate lang gearbeitet hat, plötzlich eine außerordentliche Wirkung entfaltet. Wenn wir noch Wochen nach der Veröffentlichung Briefe bekommen, in denen Leser diesen herausragenden Artikel loben und uns mitteilen, dass sie daraufhin unsere Zeitung oder unsere Website abonnieren wollen. Hervorragende Leistungen werden also doch noch wahrgenommen und wertgeschätzt.
Chipperfield: Aufgabe der Architektur muss es sein, die äußeren Strukturen zu liefern, eine Art Maschinerie, die es solchen Faktoren ermöglicht, dauerhaft zu wirken und nicht nur ab und an aufzuscheinen. Es ist übrigens interessant, was in dieser Hinsicht in Berlin passiert; die Stadt ist im Aufbruch.
Döpfner: Es ist ein bisschen wie bei einem Goldrausch: Berlin ist eine Stadt der Möglichkeiten. Da gab es zunächst ein noch vages Versprechen, dass man hier Ideen verwirklichen könne. Die Leute, vor allem junge und kreative, kamen und stellten fest: Es stimmt. Hier lassen sich tatsächlich Ideen verwirklichen. Das gilt für die Architektur, weil genug Raum vorhanden ist, und es gilt für Kunstprojekte und Start-ups, weil alles relativ billig, undefiniert und offen ist. Berlin ist noch immer eine weitgehend undefinierte Stadt.
Chipperfield Ja, die Stadt ist undefiniert, bietet aber gleichzeitig eine vielfältige Textur und hat jede Menge Charakter. Berlin ist bei aller Liebe ja keine schöne Stadt, aber es ist trotzdem voller intensiver Momente. Ich habe kürzlich einen Freund herumgeführt, der eine Weile nicht hier war. Wir fuhren zur Karl-Marx-Allee, dann zur Bismarck-Allee und hinaus nach Potsdam. Entlang unseres Weges entdeckten wir jede Menge interessante Geschichten und kraftvolle Eindrücke! Berlin ist keine Stadt der anonymen Architektur – sogar die einstigen sozialistischen Prachtbauten an der Karl-Marx-Allee haben eine unglaubliche physische Präsenz. Es ist also eine Struktur vorhanden, die ich als geradezu körperlich empfinde.

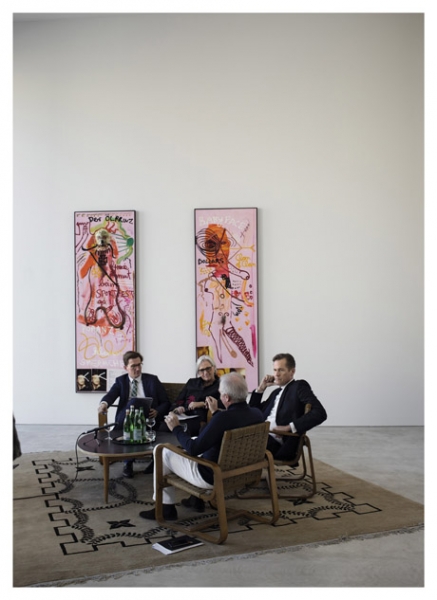
Das Galeriehaus am Kupfergraben, gegenüber dem Pergamonmuseum in Berlin gelegen, zählt zu den bekanntesten Privatgebäuden, die David Chipperfield entworfen hat. Dort trafen Brigitte Lammers, Egon Zehnder Berlin, und Michael Meier, Egon Zehnder Düsseldorf, den Architekten zum Dialog mit Mathias Döpfner.
Döpfner: Da wir gerade von Präsenz sprechen: Es würde mich interessieren, wie Sie zu den großen neuen Unternehmenszentralen im Silicon Valley stehen. Mich erinnern sie weniger an die Repräsentanzen von Unternehmen, die für Offenheit und universellen Freigeist stehen möchten, als eher an die Hauptquartiere von Geheimdiensten, die sich unter der Erde verstecken.
Chipperfield: Ein bisschen das Pentagon-Modell, nicht wahr? Allenfalls aus der Luft lassen sich die wahren Dimensionen erkennen. Ich denke, genau um diese Verschleierung geht es, was die Beziehung zwischen Unternehmen und Öffentlichkeit angeht.
Döpfner: Die Macht macht sich unsichtbar, wie neulich eine große deutsche Tageszeitung titelte …
Chipperfield: Für mich ist eine entscheidende Eigenschaft von Gesellschaften: Auf welche Weise bieten unsere Behausungen und unsere Städte uns Schutz und sorgen zugleich für Austausch und Diskurs untereinander? Wie können wir angenehm leben und unsere Privatheit genießen, ohne uns voneinander zu isolieren? Ich finde, ein nordafrikanischer Souk ist in dieser Hinsicht ein wunderbares Vorbild. Die Definition von Eigentum ist dort eher vage, Grenzen verschwimmen. Wer weiß schon genau, wo sein Laden anfängt und wo er aufhört? Auch Innen und Außen sind nicht klar definiert. Man befindet sich in einer Art dynamischer Intimität zwischen privatem und urbanem Leben. Wenn man aus den sauberen Städten Nordeuropas kommt, wo alles klar abgesteckt ist, hat das etwas Schockierendes und zugleich ziemlich Attraktives. Und meines Erachtens müssen genau das auch Unternehmen anstreben – eine Kultur des permanenten Austauschs und der fließenden Grenzen. Denn wenn es das nicht gibt …
Döpfner: … igelt sich jeder in seiner Komfortzone ein; genau.
Chipperfield: Ein festgesetztes Meeting am Donnerstagmorgen von neun bis elf Uhr ist eben nicht dasselbe, wie eigentlich absichtslos und zufällig mit Kollegen zusammenzutreffen und spontan im Gespräch eine gute Idee zu entwickeln. Mir fällt dabei ein Freund mit einer riesigen Bibliothek ein, der seine Bücher nie einräumte, sondern sie einfach stapelte. Er erklärte mir: „Ich mache das, weil ich von Zeit zu Zeit darüber stolpere und ich dann vielleicht auf ein bestimmtes Buch stoße, an das ich lange nicht mehr gedacht habe. Es mag Zufall sein, aber oft passt es genau zu dem, womit ich mich gerade befasse. Sobald ich es jedoch einsortiert habe, vergesse ich es.“ Und ich denke, genau diese Dynamik sollte auch in Unternehmen herrschen.
Döpfner: Das lässt mich wieder an den Journalismus denken. Die Aufgabe einer Zeitung besteht darin, den Horizont der Menschen zu erweitern, sie zu überraschen, aber auch zu irritieren oder zum Widerspruch zu reizen. Mithilfe neuer digitaler Technologie kann man heute allerdings messen, was die Menschen tatsächlich lesen und somit bei genügend Informationen auch prognostizieren, wofür sich eine bestimmte Person interessieren wird. Damit lässt sich das perfekt personalisierte Medienprodukt für jeden schaffen. Manche halten dies für die Zukunft des Journalismus in der digitalen Welt: Es gibt nicht länger eine Zeitung, in der die einen den anderen auf recht autoritäre Weise vorschreiben, was sie lesen und denken sollen. Nein, alles wird auf die individuellen Interessen abgestimmt. Für mich wäre es das Ende des Journalismus.
„Unternehmen müssen genau das anstreben – eine Kultur des permanenten Austauschs und der fließenden Grenzen.“ - Sir David Chipperfield
Chipperfield: Aber ich finde, die deutsche Presse hat doch wirkliche Stärken. Sie haben zum Beispiel immer noch die Tradition des klassischen Feuilletons: Jemand schreibt etwas in einer Zeitung und am nächsten Tag antwortet ein anderer Autor in einem anderen Blatt darauf. Die Debatte ist hier auch abstrakter und intellektueller als etwa in Großbritannien. Das habe ich persönlich bei der öffentlichen Auseinandersetzung über die Restaurierung und Renovierung des Neuen Museums erlebt. Alle meine deutschen Freunde haben mich bedauert. Doch meine Antwort lautete: „Als Architekt beschwert man sich ständig, dass sich niemand für Architektur interessiert. Wenn also jemand Interesse zeigt, sollte man sich wirklich nicht beklagen.“ In England gibt es nur dann eine Diskussion über Architektur, wenn Fehler gemacht werden. Norman Foster wählt den falschen Kalkstein für die Fassade des British Museum, und es gibt einen riesigen Skandal. Doch sobald er den Bau vollendet hat, spricht oder diskutiert niemand mehr darüber.
Döpfner: Ich denke, ein gewisser Grad an Kritik spiegelt auch Leidenschaft wider. Wenn man Leidenschaft für etwas empfindet, setzt man sich damit auch kritisch auseinander. Ist es einem egal, sitzt man eben unbeteiligt daneben.
Chipperfield: Es tut Architekten nur gut, wenn sie ihre Arbeit auch mal verteidigen müssen. Zu Beginn dieses Projekts kam es vor, dass Leute mich in Meetings angeschrien haben. Draußen auf der Brücke zur Museumsinsel wurde demonstriert, und es kam sogar jemand zu mir und meinte: „Herr Chipperfield, Sie haben in Berlin mehr zerstört als Winston Churchill!“ Das waren natürlich Übertreibungen. Umgekehrt haben mich einige dieser Aussagen, Vorwürfe und Fragen auch wirklich dazu gebracht, die Dinge abends auf dem Heimweg zu überdenken. Auch wenn es sich nicht unbedingt angenehm anfühlt, muss es ja nicht komplett falsch sein. Und ich muss sagen – diese kritische Auseinandersetzung schärft die Sinne.



Sir David Chipperfield,
60, wuchs auf einer Farm im britischen County Devon auf. Seine Liebe und sein Talent für die Architektur entdeckte er beim Umbau einiger Hofgebäude seines Vaters zu Ferienwohnungen. Er begann ein Architekturstudium am Kingston Technical College in London und wechselte später zur prestigeträchtigen Architectural Association School of Architecture, ebenfalls in London. Nach seinem Abschluss 1977 arbeitete er für Douglas Stephen und anschließend im gleichen Architekturbüro wie Richard Rogers und Norman Foster. 1984 machte er sich selbstständig. „David Chipperfield Architects“ unterhält heute Büros in London, Berlin, Mailand und Schanghai. Weltweite Anerkennung erhielt Chipperfield für den Wiederaufbau des Neuen Museums auf der Berliner Museumsinsel, den er 2009 nach zwölfjähriger Planungs- und Bauzeit beendete. Hoch gelobt werden auch seine Gestaltung des Literaturmuseums der Moderne in Marbach, des Figge Art Museum in Davenport und des preisgekrönten River & Rowing Museum in Henley-on-Thames. Die sensible Integration der Tradition in zeitgenössische Architektur hat Chipperfield zu einem der renommiertesten Architekten unserer Zeit gemacht und ihm zahlreiche Preise und Auszeichnungen eingebracht.

Mathias Döpfner,
Jahrgang 1963, studierte in Frankfurt am Main und Boston Musikwissenschaft, Germanistik und Theaterwissenschaften. Sein Vater Dieter C. Döpfner war Professor für Architektur. Döpfners journalistische Karriere begann 1982 bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Weitere Stationen waren Positionen als Chefredakteur bei der Berliner Wochenpost und der Hamburger Morgenpost. Seit 1998 arbeitet Dr. Döpfner für den Axel Springer Verlag, zunächst als Chefredakteur der Tageszeitung Die Welt. Seit 2002 ist er Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, deren Führung er in wirtschaftlich schwierigen Zeiten übernahm. Das Unternehmen hatte zum ersten Mal in seiner Geschichte einen Verlust zu verzeichnen. Döpfner überraschte seine Kritiker mit einem kompromisslosen, aber erfolgreichen Kostensenkungsprogramm, das unter anderem die Zusammenlegung von Zeitungsredaktionen beinhaltete. Das in der Branche zunächst kontrovers diskutierte Kooperationsmodell kopierten kurz darauf Verleger in ganz Deutschland. Heute setzt der Springer-Chef konsequent auf Digitalisierung und Internationalisierung. Durch Gründung und Akquisition von Content-Portalen, Online-Vermarktern sowie Rubriken-Portalen auf der einen Seite und die Trennung von einer ganzen Reihe von Print-Titeln auf der anderen Seite treibt Döpfner die systematische Transformation des Verlags zu einem Multimedia-Unternehmen energisch voran. Als Ausdruck dieses Aufbruchs in eine neue Ära plant das Unternehmen einen Neubau vis-à-vis dem Berliner Springer-Turm, der für neue Arbeitsweisen in einem urbanen Umfeld stehen soll, verbunden mit einer radikal neuen Ästhetik.
FOTOS: MATTHIAS ZIEGLER






